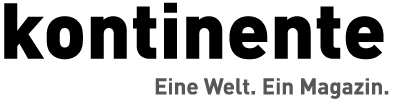

Pioniere der HoffnungDer Niger liegt in der Sahelzone, ist das ärmste Land der Welt und von Islamisten bedroht.Inmitten einer muslimischen Gesellschaft setzen sich hier Ordensschwestern für Dialog und Entwicklung ein – und bringen Dorfchefs und Imame zum Nachdenken. |
Foto: Hartmut Schwarzbach
Text: Beatrix Gramlich
Kein Fußbreit passt mehr zwischen die Wartenden in den Pavillons. Kleinkinder werden durch die Reihen zu ihren Müttern gereicht, Begrüßungen lautstark über die Köpfe der Nachbarn hinweg ausgetauscht. Während aus den Lautsprechern Afropop dröhnt, strömen noch immer Menschen auf das Gelände. 350 werden es am Ende sein – so viele wie nie zuvor: Imame, Dorfvorsteher, die Garde des Sultans in ihren leuchtend roten Gewändern, bunt verschleierte Frauen.
Eine Frau mit weißem Schleier sticht aus der Menge hervor. Ihretwegen sind sie hier: Schwester Marie Catherine Kingbo, Oberin der „Dienerinnen Christi“, hat Vertreter aus zwölf Dörfern in ihr Kloster in Tibiri, einem Vorort von Nigers drittgrößter Stadt Maradi, eingeladen. Die 66-Jährige sitzt an dem einzigen Tisch im Pavillon und registriert aufmerksam, wer gekommen ist. In den vergangenen Wochen hat sie im Umkreis von Kilometern Handzettel verteilen lassen und um die Teilnahme an der Veranstaltung geworben. „Essen und Transportkosten werden übernommen“, heißt es da und: „Nous comptons sur votre présence“ – wir rechnen mit Ihrem Erscheinen.
Einmal im Jahr organisiert die Ordensfrau mit ihren Mitschwestern diese Versammlungen. Die heute ist ihre sechste. Sie haben dabei über Familienleben gesprochen, über Hygiene und Gesundheit oder den Frauen ganz praktische Dinge wie die Herstellung von Seife oder Färbemitteln beigebracht. Zu Mariä Himmelfahrt 2018 hat Schwester Marie Catherine mit den Dorfbewohnern die Bedeutung von Maria in Christentum und Islam erarbeitet. An diesem Samstag geht es um Beschneidung, Zwangsheirat, Polygamie – heikle Themen in einer patriarchalisch-muslimischen Gesellschaft, in der die Zahl der Ehefrauen nicht unerheblich zum Ansehen eines Mannes beiträgt. Die Männer betrachten die Vielehe als Teil ihrer Tradition, die sie aus dem Koran ableiten, die Ordensfrau sieht darin Bremsen der Entwicklung, die der Niger so dringend braucht.
Ärmstes Land der Welt
Der Sahelstaat bildet das Schlusslicht auf dem Index für menschliche Entwicklung. Neun der rund 22 Millionen Einwohner leben in extremer Armut, knapp die Hälfte der Bevölkerung hat weniger als 1,70 Euro am Tag zur Verfügung. Und Besserung ist nicht in Sicht. Seit der Regen, den der westafrikanische Monsun früher zuverlässig von Mai bis Oktober brachte, immer häufiger ausbleibt, leiden die Menschen zunehmend unter Dürren und Hungersnöten. Viele Getreidespeicher sind schon Monate vor der nächsten Ernte leer.
Schwester Marie Catherine tippt prüfend ans Mikrophon und wirft einen letzten Blick auf ihr Laptop. „Heute wollen wir auf das schauen, was den Niger davon abhält, sich zu entwickeln“, erklärt sie und beginnt, über Sklaverei und Monokulturen zu sprechen, die die französischen Kolonialherren den Einwohnern aufgezwungen haben. Das Publikum quittiert ihre Ausführungen mit Kopfnicken. Alle sind sich einig, dass ihr Land noch immer unter den Folgen der Fremdherrschaft leidet. Einige Männer melden sich zu Wort und bekräftigen, wie sehr Frankreich den Niger in seiner Entwicklung gebremst habe.
Tabus in der Männerwelt
Geschickt nutzt die Ordensfrau die positive Stimmung, um das erste heiße Eisen anzupacken: die Beschneidung von Mädchen – eine jahrhundertealte, grausame Tradition, die in den ländlichen Regionen bis heute verbreitet ist und bei den Betroffenen oft ein Leben lang gesundheitliche Probleme verursacht. Vor zwei Tagen, am internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung, berichtet Schwester Marie Catherine, hätten Mädchen im Radio Zeugnis von ihrem Leid gegeben. In der Ecke, in der die Frauen sitzen, wird es unruhig. Die meisten sind selbst Opfer von Zwangsbeschneidung und haben auch ihre Töchter dazu gedrängt. Die Männer verfolgen das Geschehen mit reglosen Mienen. Manche lassen Gebetsketten durch ihre Finger gleiten.
Schwester Marie Catherine wechselt derweil unbeirrt zum nächsten Punkt: Zwangsehe. Im Niger bedeutet das häufig nicht nur eine unfreiwillige Verbindung, sondern auch, dass schon zehn-, zwölfjährige Mädchen mit Männern verheiratet werden, die ihre Großväter sein könnten. „Wir kämpfen seit Jahren dagegen und gegen die frühen Schwangerschaften“, ruft die Ordensfrau in die Menge. „Hat sich etwas verändert?“ „Ja“, antworten die Männer. „Wir schicken die Mädchen jetzt in die Schule“, sagen die Frauen. Der Vertreter des Sultans spricht sogar von einem Bewusstseinswandel.
Guter Draht zum Sultan
Sein Chef, der Sultan von Tibiri, Abdou Balla Marafa, ist ein großer Befürworter von Schwester Marie Catherines Arbeit. Er residiert in einem riesigen, aber ärmlichen Palast und ist das Oberhaupt der Goubur: ein Volk aus dem mittleren Osten, das die Flucht vor kriegerischen Auseinandersetzungen im Lauf seiner mehr als tausendjährigen Geschichte bis in den Niger geführt hat. Mit Sorge beobachtet Abdou Balla Marafa die wachsenden Probleme im Land: die unsichere Ernährungslage, den Ausbruch der Cholera während der letzten Regenzeit, die Bedrohung durch islamistische Fundamentalisten. „Mittlerweile gibt es hier große Spannungsherde“, sagt er. Aus dem benachbarten Mali und Tschad dringen Boko Haram-Kämpfer in die Grenzgebiete ein, plündern Häuser, entführen Kinder und erpressen Lösegeld. Nach den Anschlägen auf die französische Satirezeitschrift Charly Hebdo im Januar 2015 wurde die Missionsstation der Weissen Väter im 230 Kilometer entfernten Zinder von einem Mob wütender Muslime verwüstet. Eine Einheit der Polizei schützte damals eine Woche lang das Kloster der Schwestern in Tibiri, seitdem sind ständig zwei Wachposten dort stationiert. Weil es immer wieder Angriffe auf Gläubige gab, ließ die katholische Gemeinde in Maradi eine Mauer um das Gelände der Kathedrale ziehen.
Die fehlende Sicherheit bringe den gesamten Niger aus dem Gleichgewicht, befürchtet der Sultan. Was, wenn die Stimmung kippt und sich der bisher liberale Islam in dem Sahelstaat radikalisiert? „Gegenseitige Annäherung, Respekt, den anderen kennen und verstehen lernen“: Das sind für Abdou Balla die besten Waffen im Kampf gegen Extremismus – und genau die Mittel, die Schwester Marie Catherine einsetzt. Deshalb hat er auch dafür gesorgt, dass Radio und Fernsehen landesweit über ihre interreligiösen Veranstaltungen berichten.
Bei ihren Treffen versucht die Ordensfrau, bei Christen wie Muslimen Verständnis füreinander zu wecken. Doch Vorurteile, eingefleischte Verhaltensweisen und Traditionen aufzubrechen, die seit Generationen in den Köpfen verankert sind, erfordert Geduld, Einfühlungsvermögen, oft auch Zurückhaltung. Demut ist für Schwester Marie Catherine ein wichtiger Bestandteil ihrer Spiritualität und gehört zu ihrem Dienst an den Armen.
Die gebürtige Senegalesin hatte als junge Frau in ihrer Heimat einen guten Job, ein Haus, ein Auto. „Ich habe nie daran gedacht, ein geweihtes Leben zu führen“, sagt sie. „Als ich den Ruf des Herrn vernahm, habe ich dagegen angekämpft.“ Doch ihre Gegenwehr hielt nicht lange. Im Alter von 22 Jahren trat sie den „Töchtern des Heiligen Herzens Mariens“ bei und war später viele Jahre deren Generaloberin. Während eines Sabbatjahrs in Paris reifte ihre Entscheidung, den Menschen in einem muslimischen Land Christi Liebe zu zeigen. 2006 gründete sie in Maradi die Gemeinschaft der Dienerinnen Christi und begann mit der Arbeit in den Dörfern. „Als ich die Armut dort sah, habe ich nächtelang geweint“, erinnert sie sich.
Sabiro, 30 Kilometer von Maradi entfernt, ist eines dieser Dörfer, wie es Tausende im Niger gibt. In der heißen, staubigen Luft, die der Wüstenwind Har-mattan vor sich hertreibt, zeichnen sich die geduckten Lehmbauten kaum vom Himmel ab. Der Hof von Halilou dan Maimai ist der größte: ein umfriedetes Geviert, an dessen Mauern ein paar niedrige Räume kleben: je ein Schlafzimmer für seine Frauen und ihn, ein kleiner Laden, in dem er Nudeln, Reis und Zucker vom Markt gegen geringen Aufpreis weiterverkauft. Draußen jagen Kinder mit aufgeblähten Bäuchen hinter zerfetzten Plastiktüten her. Einige kauen die wilden Früchte des Kossoré-Baums. Die hölzernen Hirsemörser liegen auf der Seite – ein Zeichen dafür, dass die Vorräte aufgebraucht sind.
Halilou ist Dorfchef von Sabiro. Er trägt die Jalaba, das traditionelle Hemd der Muslime, auf dem Kopf die schiffchenförmige Houalla Koube. Halilou ist ein angesehener Mann mit zwei Frauen und 20 Kindern. Von Anfang an hat der 41-Jährige die Veranstaltungen der Schwestern besucht. In seinem Dorf habe sich dadurch viel verändert, meint er. Mit Hilfe eines Mikrokredits hätten sie eine Ziegenzucht aufbauen können, die Frauen seien besser gekleidet als früher, es gebe keinen Hunger mehr – und keine Zwangsheiraten. Halilou hat nie eine Schule besucht. Auch seine Kinder gehen nicht zum Unterricht. Die nächste Schule ist 17 Kilometer entfernt und nicht mehr als eine lange Lehmhütte, in der es weder Tische noch Bänke gibt. Die Kinder sitzen auf dem nackten, sandigen Boden. „Im Sommer, wenn es heiß ist“, erzählt Schwester Marie Catherine, „kriechen die Schlangen aus der Erde.“
Vor Halilous Hof sitzen die Alten auf Plastikstühlen und schlagen die Zeit tot. Frauen, die an der Mauer lehnen, bitten Schwester Marie Catherine um Essen für ihre Familien. Eine Gruppe junger Männer berichtet, dass die Aussaat auf den Feldern nicht wächst. „Selbst wenn es regnet, gedeihen die Pflanzen nicht, weil der Boden schlecht ist“, klagen sie. Sie bräuchten dringend Dünger, aber dafür fehlt ihnen das Geld.
Schwester Marie Catherine und ihre Mitschwestern kennen die Armut, den Hunger, die Hoffnungslosigkeit und versuchen, den Menschen Auswege zu eröffnen. In Dan Baku haben sie eine zweite Gemeinschaft gegründet und teilen das einfache Leben der Dorfbewohner. Sie vergeben Mikrokredite und zeigen ihnen, wie sie sich mit der Herstellung von Seifen und Färbemitteln oder der Zucht von Hühnern und Ziegen ein kleines Einkommen erwirtschaften können. Hier haben sie auch ein Zentrum für unterernährte Kinder aufgebaut, in Tibiri eine Schule mit Kindergarten; 90 Prozent der Jungen und Mädchen stammen aus armen Familien. Vor einem halben Jahr sind zwei Schwestern in die zerstörte Missionsstation der Weissen Väter in Zinder gezogen und helfen, die Arbeit dort wieder aufzubauen.
Frauen gehören ins Haus
Doch auch die Ordensfrauen stoßen an Grenzen. Bei der Versammlung beharren die Männer darauf, dass die Frau sich um Haus und Familie zu kümmern und keinen Platz in der Gesellschaft habe. Ein Imam betont, der Islam weise ihr diese Rolle zu, weil sie ungebildet sei. Ein Dorfchef will sogar eine Sure im Koran kennen, die das bestätigt. Mit dem Widerspruch von Schwester Marie Catherine hat er nicht gerechnet. „Ich habe viele Studien zum Islam gemacht“, kontert sie, „aber eine Sure, die der Frau verbietet, das Haus zu verlassen, ist mir nie begegnet.“ Jetzt meldet sich eine gepflegte, junge Frau zu Wort. Aufgebracht berichtet sie von Männern, die sich nicht um ihre Frauen kümmern, wie der Koran es verlange. Eine andere fragt: „Wie soll die Frau in einem Haus bleiben, in dem es weder zu essen noch zu trinken gibt?“ Während sie lautstarken Beifall erntet, hämmert Schwester Marie Catherine die Beiträge in ihren Laptop. Die Treffen seien eine große Chance für die Frauen, erklärt sie. „Hier sagen sie, was sie denken, zu Hause trauen sie sich das nicht. Da ist alles Zwang für sie.“
Am Ende fragt Schwester Marie Catherine ihre Zuhörer, was helfen würde, den Niger voranzubringen. Die Frauen wünschen sich Fabriken, in denen die jungen Leute Arbeit finden, damit sie in ihrer Heimat bleiben und das Land nicht verlassen. Die Männer bitten die Ordensfrau um Dünger für ihre Felder. Akribisch notiert sie, wieviel Kilo jedes Dorf braucht und verspricht, Unterstützung zu suchen.
Verkehrte Welt
Halilou ist ins Grübeln gekommen. Als die Veranstaltung vorbei ist, fragt er, ab welchem Alter Mädchen eigentlich heiraten dürften. Und ein Imam erzählt: „Früher haben wir nur schlecht über die Christen geredet. Sie haben uns als Sklaven genommen und ihr Französisch aufgezwungen. Erst jetzt fangen wir Muslime an, die Christen zu verstehen.“ Der 80-jährige Ibrahim Moussa, der zum ersten Mal zu einem Treffen gekommen ist, sagt: „Ich finde es gut, dass Christen und Muslime hier unter einem Dach sitzen. Wir teilen dieselben Werte, weil wir denselben Gott haben.“ In seinem Dorf wird er von der kleinen, resoluten Schwester erzählen, die die Verhältnisse auf den Kopf stellt. Die als Frau und obendrein Christin vor den Männern sitzt, sie zum Nachdenken bringt und ihnen Paroli bietet. Doch schon nach der ersten Versammlung, zu der sie eingeladen hatte, sagten die Männer zu ihr: „Machen sie weiter! Wenn es mehr Frauen wie sie gäbe, sähe es im Niger anders aus.“
Zurück zur Startseite
Zurück zur Nachrichtenübersicht
  | Kontakt | FAQ | Sitemap | Datenschutz | Impressum |