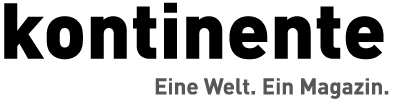

Das Taizé des OrientsMar Musa al-Habashi: Der Name des syrischen Wüstenklosters klingt nach Morgenland, Mystikund uralten Zeiten. Der italienische Jesuitenpater Paolo Dall'Oglio hat die 1000 Jahre alte Ruine mit neuem Leben erfüllt und zu einem Ort für alle gemacht, die die Sehnsucht nach dem Unendlichen treibt. |
Text: Beatrix Gramlich; Fotos: Hartmut Schwarzbach
Wenn der Morgen dämmert und ein atemberaubender Sternenhimmel im Zwielicht versinkt, ist Mar Musa ein Ort der absoluten Stille. Kein Windhauch streicht über die Steine, kein Vogelschrei zerreißt die Luft. Auf dem Weg von Damaskus nach Aleppo, eine halbe Stunde Fußmarsch hinein in die Jabal al-Qalomoun-Berge, hängt das Kloster wie ein Nest in den Felsen. In den kargen, unbeheizten Zimmern schlafen die Gäste den Schlaf der Gerechten. Die Nacht war kalt in der Wüste. Manch einer hat stundenlang wach gelegen und sich irgendwann verzweifelt in die dritte Lage Decken gewickelt.
Der Tagesanbruch gehört den Mitgliedern des Klosters. Wie eine Familie versammeln sie sich in der alten Käserei, genießen den Luxus einer Tasse Instantkaffee und die Geborgenheit, die das morgendliche Ritual im vertrauten Kreis vermittelt. Sechs Mönche, zwei Schwestern und drei Novizen aus der katholischen Kirche und den christlichen Kirchen des Orients zählt die kleine internationale Gemeinschaft, die der italienische Jesuit Paolo Dall’Oglio 1991 gegründet hat. Selten sind sie alle zugleich in Mar Musa. Zwei von ihnen studieren gerade in Rom, einer in Damaskus; Jacques, von der ersten Stunde an Paolos Mitstreiter, arbeitet als Gemeindepriester eine halbe Stunde Autofahrt entfernt in Quayad.
Hymnen beflügeln die Seele
Um sieben Uhr schickt die Zinnglocke im Hof ihr metallisches Geläut über die Berge. Zeit für die Laudes. Die Klostergemeinschaft und eine Handvoll schlaftrunkener Gäste versammeln sich in der Felsenkirche, lassen sich mitnehmen von der Schönheit der Psalmen und Hymnen, die in Arabisch und Altsyrisch gelesen und gesungen werden. Es folgen Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament, eine kurze Bibelauslegung und Gebete.
Tagsüber hat niemand im Kloster eine bestimmte Aufgabe. Keiner soll sich zu schade für etwas sein, jeder anpacken, wo gerade Hilfe gebraucht wird: beim Saubermachen, in der Küche, bei der Bewirtung der Gäste und mittwochs, am Waschtag, wenn das ganze Kloster unter Dampf steht. „Wir haben keinen festen Zeitplan“, erklärt Paolo Dall'Oglio. Dem temperamentvollen Pater, der Mar Musa vor knapp drei Jahrzehnten aus dem Dornröschenschlaf geweckt hat, sind andere Dinge wichtiger: der eigenen Hände Arbeit, Gastfreundschaft, die Begegnung der Religionen, vor allem aber Spiritualität. Die Wüste, glaubt er, ist ein guter Ort dafür. Mose, Elias, Johannes der Täufer, Jesus – sie alle haben schließlich dort ihre Gotteserfahrungen gemacht. „Die Wüste“, sagt Paolo, „eröffnet Raum für die Verbindung mit Gott. Weil sie leer ist.“
Als er Mar Musa al-Habashi 1982 entdeckt, übt dieser Ort vom ersten Augenblick an eine magische Anziehungskraft auf ihn aus. 27 Jahre alt ist er da und seit sieben Jahren in der Gesellschaft Jesu. Neben Theologie und Philosophie hat er in Neapel und Damaskus Islamwissenschaften studiert. Er hat nachts mit den Sufis in den Moscheen getanzt und bereitet sich auf die Priesterweihe vor. Schon als Novize fasziniert ihn die Inkulturation des Glaubens. Während der Generalobere zu Besuch ist, nimmt Paolo all seinen Mut zusammen und gesteht ihm, er wolle „sein Leben dem Heil der Muslime widmen. Wir müssen uns gegenseitig Zugang zum Mysterium geben.“ Einer Vision gleich hatte er eines Tages das Wort „Islam“ am Horizont stehen sehen – „die große Herausforderung der Kirche“. Es ist wie eine zweite Berufung. So eindeutig und unwiderstehlich wie damals, als er einem Freund gerade seine Zukunftspläne schildern wollte und plötzlich spürte, dass Gott ihn rief. Auf dem Heimweg in den Straßen Roms „explodierte ich vor Freude“, erinnert sich der 56-Jährige. „Ich war wirklich geliebt. Unendlich geliebt. Geliebt ohne Bedingung.“
Anfang der 80er-Jahre stürzt der junge Jesuit in eine Glaubenskrise. Auf der Suche nach einem Platz für Exerzitien stößt er in einem alten Reiseführer auf Mar Musa, ein aufgegebenes Kloster in der syrischen Wüste. Paolo packt ein paar Sachen zusammen und macht sich auf den Weg. Als er den Berg nach Mar Musa hochkraxelt, wird es schon dunkel.
Das Gefühl, angekommen zu sein
Die Ruine ist alles andere als ein gastlicher Ort: das Dach eingestürzt, das Gemäuer verfallen, die 1000 Jahre alte Freskenmalerei in der Felsenkirche jedoch wie durch ein Wunder erhalten. Paolo ist überwältigt. Die ganze Geschichte des Orients scheint ihm hier zu begegnen. Er breitet seinen Schlafsack auf der Terrasse aus, die ihm am sichersten scheint, und verspeist im Schein der Taschenlampe eine Dose Sardinen. Doch vom ersten Augenblick an hat er das Gefühl, angekommen zu sein. „Ich habe den Ort meines Lebens entdeckt“, sagt der Pater rückblickend. „Ich dachte sofort: Das ist ein Platz für Spiritualität.“
Das alte Kloster lässt ihn nicht mehr los. Er ist überzeugt, dass diese christliche Stätte inmitten einer muslimischen Gesellschaft den Menschen noch immer etwas zu sagen hat, und setzt Himmel und Hölle für deren Wiederaufbau in Bewegung. 1991, als die Jesuiten ihn als Pfarrer nach Homs schicken wollen, widersetzt er sich und gründet mit Jacques, einem Seminaristen aus Aleppo, die Gemeinschaft von Mar Musa. Die beiden Männer wollen es in einen Ort verwandeln, an dem sich die Religionen begegnen und Menschen die Universalität von Gottes Botschaft erleben.
Während er erzählt, schweifen Paolos Blicke über die Terrasse. Längst ist sie instand gesetzt und zum Treffpunkt von Mönchen und Schwestern, Tages- und Übernachtungsgästen geworden. Aus der Kirche drängt gerade eine Gruppe Muslime. Sie haben ihre Schuhe ausgezogen und die Fresken bewundert, die vom Jüngsten Gericht erzählen, von Propheten und Evangelisten, Mönchen und Heiligen, Pharisäern und Verfluchten. Manche haben sich auf die Teppiche gekniet, der weißen Wand Richtung Mekka zugewandt, und gebetet. Am Freitag, ihrem Feiertag, strömen die Muslime in Scharen hierher. Für sie war Mar Musa schon immer eine geheiligte Stätte, ein Ausflugsziel ist es allemal.
Alt-Hippies, Sinnsucher, Kopftuchfrauen
Im Klosterhof sitzen Frauen mit Kopftüchern neben langhaarigen Rucksacktouristen, der rumänische Botschafter trifft auf Raimon, den Handwerker aus Sednaya, den es seit zehn Jahren immer wieder hierher zieht. „Ich liebe die Stille, das spirituelle Leben der Gemeinschaft“, sagt er. „Dieser Platz öffnet mein Herz für Gott.“ Diane, die französische Novizin, und Houda, die syrische Nonne, stehen etwas abseits und unterhalten sich mit muslimischen Gästen. Danial serviert ein paar Neuankömmlingen Ziegenkäse. Manchmal, gesteht der Novize, werde ihm der Trubel zu viel. „Du hast ständig mit vielen Menschen aus verschiedenen Kulturen zu tun“, sagt er, und „manche haben keine Ahnung vom Klosterleben.“ Dann ist der Maronit froh, wenn er sich zurückziehen kann. Zehn Minuten vom Kloster entfernt hat er sich eine Felshöhle eingerichtet, wie sie früher die Eremiten hier in den Bergen bewohnten. Der karge Raum mit Matratze und Schlafsack, Vorratsschränkchen und Bollerofen reduziert seine Gedanken auf das Wesentliche. Draußen hat er sich einen steinernen Tisch gebaut. Hier sitzt er gern, den Blick auf die Wüste gerichtet, liest in der Bibel, betet und meditiert. Kontemplation gehört zu den Grundpfeilern der Gemeinschaft von Mar Musa. Einen Tag pro Woche zieht sich jeder zum Gebet zurück, zweimal im Jahr gehen sie sieben Tage zu Exerzitien in die Einsamkeit – die Frauen in die Eremitage des Klosters, die Männer in eine Felshöhle.
So hat es sich Paolo immer gewünscht. Mar Musa sollte nicht zur Touristenattraktion verkommen, sondern ein Ort der Mystik werden. Ein Ort der Begegnung mit Gott und den Menschen – für Christen und Muslime, Arme und Reiche, für alle, die auf der Suche sind. Denn der Dialog der Religionen, so die Überzeugung des Jesuiten, bereichert jeden, ohne dass er die eigenen Wurzeln aufgeben muss. Worum es ihm geht, ist die gemeinsame Suche nach der Wahrheit.
Längst ist das Wüstenkloster auf dem Weg, sich zum Taizé des Orients zu entwickeln. Jeder ist willkommen. Jeder erhält ein Bett und Essen umsonst. Das Kloster lebt von den Spenden, die in dem kleinen Holzkasten gegenüber der Kirche landen. Sie sei hier, „um eine neue Lebensausrichtung zu finden“, erzählt die Freiburgerin Friederike Gräf. Susannah Baker-Smith aus London reizt vor allem die Begegnung der Religionen. Wie wichtig ihnen die Gäste sind, betont Houda, die Novizenmeisterin. „Wir respektieren ihre Gefühle und trinken zum Beispiel keinen Wein, wenn Moslems hier sind. So bezeugen wir Jesu Liebe zu allen Menschen.“ In ihrer besonnenen Art bildet die 45-Jährige den ruhenden Gegenpol zum Energiebündel Paolo, dessen laut tönende Stimme immer wieder über das Gelände schallt. An einem Tisch bietet er Käse an, am nächsten erklärt er einer Gruppe italienischer Priester Mar Musas Geschichte. Zwischendurch bittet er Diane, der Reisegruppe aus Schweden ihre Zimmer zu zeigen.
Manche, die sich von der Gemeinschaft getrennt haben, werfen ihm Dominanz vor. Aber ohne seinen Elan, seinen Idealismus und seine Beharrlichkeit, die er vorübergehend mit dem Ausschluss von den Jesuiten bezahlt hat, wäre das Wüstenkloster im Morgenland vermutlich nie mehr zu einer lebendigen Stätte des Christentums geworden.
Wenn die Dunkelheit sich über die Berge senkt, versammeln sich Mönche, Schwestern, Novizen und Gäste zu Meditation und Gottesdienst. Sie setzen sich auf die Teppiche, die den felsigen Boden der Kirche bedecken, und versinken in Stille. Paolo zelebriert nach syrischem Ritus. Weihrauch schwängert die Luft, die fremd klingenden Worte und Gesänge mit ihrem ganz eigenen Rhythmus beflügeln den Geist, berühren das Herz – und machen frei für die Begegnung mit Gott.
Sie möchten mehr kontinente lesen? Bestellen Sie hier Ihr kostenloses Probeabo.
In jahrelanger Arbeit restauriert und mit neuem Leben erfüllt: Das syrische Wüstenkloster Mar Musa al-Habashi in den Jabal al-Qalomoun-Bergen nördlich von Damaskus.
Organisation: Für Pater Paolo gehen im Büro Anfragen aus aller Welt ein. Mar Musa bekommt schnell den Beinamen „Taizé des Orients“.
Sehnsuchtswelt: Seit Jahrhunderten kommen Menschen nach Mar Musa, um in die Stille einzutauchen und Gott zu suchen. So wie Danial im Morgengrauen.
Gastfreundschaft: Die Käserei hilft, die vielen Besucher zu verköstigen.
Begegnung: Für Muslime wie Christen ist die Felsenkirche ein geheiligter Ort.
Mit ihrem metallischen Geläut kündigt die Zinnglocke im Klosterhof die Gebetszeiten an.
Gemeinschaft: Die Heilige Messe geleitet in syrischem Ritus zur Nacht. Gebete und meditative Gesänge sprechen alle an: Gläubige, Zweifler und Suchende.
Jesuitenpater Paolo Dall‘Oglio vor dem syrischen Wüstenkloster Mar Musa al-Habashi.
Herzlichkeit: In Mar Musa wird orientalische Gastfreundschaft groß geschrieben. Jeder Besucher ist willkommen. Die Mahlzeiten sind für alle kostenlos.
Stille: Sooft er kann, zieht sich Danial zu Gebet und Meditation in seine Felshöhle zurück.
  | Kontakt | FAQ | Sitemap | Datenschutz | Impressum |












