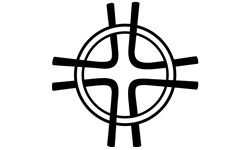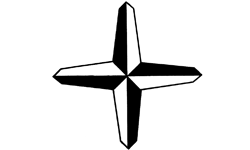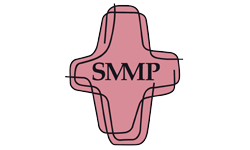Die verschwiegenen JüngerinnenFrauen spielten bei den frühen Christen eine bedeutende Rolle. Es gab Apostelinnen, Diakoninnen, Missionarinnen.
Frauen leiteten Gemeinden und verkündeten die Frohe Botschaft. Warum sind diese Frauen so wenig bekannt,
wurden abgewertet oder zu Männern gemacht? Eine Spurensuche. |
Text: Beatrix Gramlich
Fotos: Liszt Collection/piture alliance
Kennen Sie Lydia: Purpurhändlerin, Geschäftsfrau und „Gottesfürchtige“? Oder Phöbe, die den Römerbrief überbringt? Was sagt Ihnen die Apostelin Junia? Frauen führen in der Bibel ein Schattendasein. Die meisten bleiben namenlos. Dabei begleiten sie Jesus von Anfang an.
Als Jesus gekreuzigt wird, sind die Jünger geflohen. Die Frauen stehen ihm bei – wenn auch nur „von Weitem“, weil die Hinrichtungsstätte abgesperrt ist. Unter ihnen sind „Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome; ... Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren“, heißt es im Markusevangelium (15, 40-41), dem ältesten der Evangelien. Immer wieder betont Markus, dass es vor allem die Frauen sind, die umsetzen, was Jesus als Nachfolge fordert: zu dienen.
In den jüngeren Evangelien ändert sich das: Die Frauen werden weniger, ins Zentrum rücken die Apostel. „Die Zwölf begleiteten ihn und auch einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt worden waren“, berichtet der Evangelist Lukas (8,2). Eine von ihnen ist Johanna. Sie stammt aus der Hofgesellschaft, ihr Mann, Chuza, ist ein hoher Beamter von König Herodes. Johanna verlässt ihn, um Jesus zu folgen – ein Skandal zur damaligen Zeit! Sie bringt Vermögen mit und unterstützt damit die neue Bewegung. Verpflegung, Räume wie für das letzte Abendmahl, das in einem Stück gewebte Gewand Jesu werden ihr zugeschrieben. Johanna ist auch eine der Frauen, die am Ostermorgen ans Grab gehen. Lydia (Apg 16,14) hingegen taucht nur ein einziges Mal in der Bibel auf: Als Paulus nach Philippi kommt, drängt sie ihn, bei ihr zu wohnen. Was er verkündet, überzeugt sie. Die Jüdin lässt sich und ihr ganzes Haus taufen. Wahrscheinlich wird es bald zum Treffpunkt der Christengemeinde, in der sie als selbstbewusste Gastgeberin und Erstbekehrte in Philippi eine Führungsrolle übernimmt.
Phöbe: Diakonin oder Dienerin?
Auch Phöbe ist eine der Frauen mit besonderer Stellung. Paulus beauftragt sie, den Römerbrief zu überbringen (Röm 16,1). Damit ist sie weit mehr als eine Briefträgerin. „Wer in der Antike einen Brief bringt, der liest ihn vor, der kann ihn auslegen. Phöbe hatte auf jeden Fall eine leitende Funktion“, sagt Katrin Brockmöller, 49, Bibelwissenschaftlerin und geschäftsführende Direktorin des Bibelwerks. Der griechische Text nennt Phöbe „Diakonos“, Diakonin, und „Prostátis, was so viel wie Vorsteherin bedeutet. In der Einheitsübersetzung wird sie zur „Dienerin der Gemeinde“. „Abwertend“, findet Sabine Bieberstein, 60, Professorin für Exegese an der Universität Eichstätt-Ingolstadt, und weist darauf hin, dass Männer in ähnlicher Stellung als Diakone und Bischöfe bezeichnet wurden. „Richtig übersetzt“, meint hingegen Heike Grieser, 57, die an der Universität Mainz Kirchengeschichte lehrt. Paulus habe kein festes Amt vor Augen gehabt, als er den Römerbrief schrieb.
„Im ersten und zweiten Jahrhundert entwickeln sich die Ämter erst“, erklärt Brockmöller. „Es gibt sie nicht überall, sie heißen nicht überall gleich und bedeuten nicht immer dasselbe.“ Folgt man den Kirchenlehren, übernehmen vor allem Witwen und Jungfrauen, Diakoninnen und Apostelinnen in den frühen Christengemeinden Ämter. Ihr Dienst wurde besonders da gebraucht, wo es um Frauen ging: bei Krankenbesuchen oder der Taufe, die damals noch eine Ganzkörpertaufe war. Denn die antike Gesellschaft trennte streng nach Geschlechtern.
Junia: eine Apostelin wird zum Mann
Eine dieser Apostelinnen ist Junia, die Frau des Andronikus. Wie andere jüdische Ehepaare missionieren die beiden gemeinsam. Paulus nennt sie herausragend unter den Aposteln (Röm 16,7). Auch frühe Kirchenväter sprechen mit Hochachtung von ihr. „Wie groß muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel würdig befunden wurde“, schreibt Johannes Chysostomos. Im 13. Jahrhundert aber wird Junia plötzlich zum männlichen Junias. Ein Abschreibefehler oder bewusste Umdeutung? „Dass eine Frau einen Aposteltitel tragen könnte, war zu dieser Zeit nicht mehr vorstellbar“, erklärt Bieberstein. Kirche und Gesellschaft waren patriarchalisch. „Später galt vielleicht, dass nicht sein kann, was nicht sein darf.“ Erst in der Einheitsübersetzung von 2016 erhielt Junia ihren ursprünglichen Namen zurück – obwohl der Fehler damals schon Jahrzehnte bekannt war.
Die Grundlagen dafür lieferte die feministische Theologie, die seit den 1970er-Jahren den Blick auf die frühen Christinnen lenkte. „Sie versuchte, diese Frauen dem Vergessen oder Verschweigen zu entreißen, ihre besonderen Rollen zu belegen und zu zeigen, wie sie unsichtbar gemacht oder abgewertet wurden“, erklärt Bieberstein. „Feministische Theologie war immer auch Befreiungstheologie“, sagt Brockmöller.
Als Quellen dienen neben der Bibel religiöse Texte, die keinen Eingang die Heilige Schrift gefunden haben: sogenannte Apokryphen wie das Evangelium der Maria von Magdala, der Maria, die Thekla-Akten, Briefe, Sprüche und Apokalypsen. Aufschluss liefern auch die Lehren der Kirchenväter und antike Schriften. Junia durfte nicht zuletzt deshalb wieder zur Frau werden, weil es auf Grabmälern, Inschriften und in der gesamten antiken Literatur keinen einzigen Beleg für den Männernamen Junias gibt.
In den Anfängen war die Jesusbewegung vermutlich egalitär und damit anziehend – vor allem für Griechinnen, die ein freieres Leben gewohnt waren. Im Lauf der Zeit passte sie sich jedoch den patriarchalischen Strukturen an, die sich auch in den späteren Evangelien widerspiegeln. Dennoch: „Wenn man anfängt, die biblischen Texte aufmerksam und kritisch zu lesen, lassen sich viele bemerkenswerte Frauen entdecken, die Verantwortung übernahmen, Ämter in den Gemeinden ausübten, verkündeten, organisierten und leiteten“, sagt Bieberstein. „Aus biblischer Perspektive gibt es keinen Grund, Frauen heute von irgendwelchen Ämtern auszuschließen.“

Heike Grieser, 57, ist Professorin für Kirchengeschichte und Dekanin der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Mainz.
Namenlose Frauen in der Bibel und feministische Theologie: Interview mit Heike Grieser
Frau Professor Grieser, warum bleiben viele Frauen in der Bibel namenlos oder wurden wie Junia zum Mann?
Namenlos bleiben Frauen vor allem dann, wenn sie aus Sicht der männlichen Autoren keine wichtige rolle spielen. Dass Junia (Röm 16,7) über viele Jahrhunderte für einen Mann gehalten wurde, hängt mit fehlenden Akzenten bei ihrem griechischen Namen zusammen. Ohne sie ist unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Erwartungshaltung war: Ein Apostel ist selbstverständlich ein Mann.
Was verändert sich durch die feministische Theologie?
Wer aus der Perspektive von Frauen forscht, hinterfragt auch das vermeintlich Selbstverständliche. Dadurch können geschichtlich gewachsene Engführungen aufgebrochen und neue Schätze aus der Tradition gehoben werden – auch um gegenwärtige Fragen zu lösen.
Wo stößt sie auf Abwehr?
Fragen der feministischen Theologie und die Genderperspektive werden häufig als ein Spezial- oder Randthema betrachtet. Dabei weiten sie den Horizont und sensibilisieren für die Situation von Frauen in der Kirche. Wenn man zeit- und kontextbedingte Elemente in der Entwicklung der kirchlichen Ämter erkennt, gibt das Spielraum für neue Entscheidungen, die dem Leben von Männern und Frauen heute angemessen sind.
Interview: Beatrix Gramlich
Zurück zur Nachrichtenübersicht November/Dezember 2022
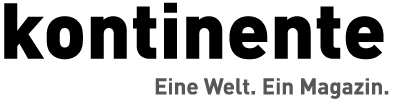



 Der Film erzählt von Schwester Marie Catherine im Niger, die zur Versöhnung von Muslimen und Christen im ärmsten Land der Welt beiträgt.
Der Film erzählt von Schwester Marie Catherine im Niger, die zur Versöhnung von Muslimen und Christen im ärmsten Land der Welt beiträgt.